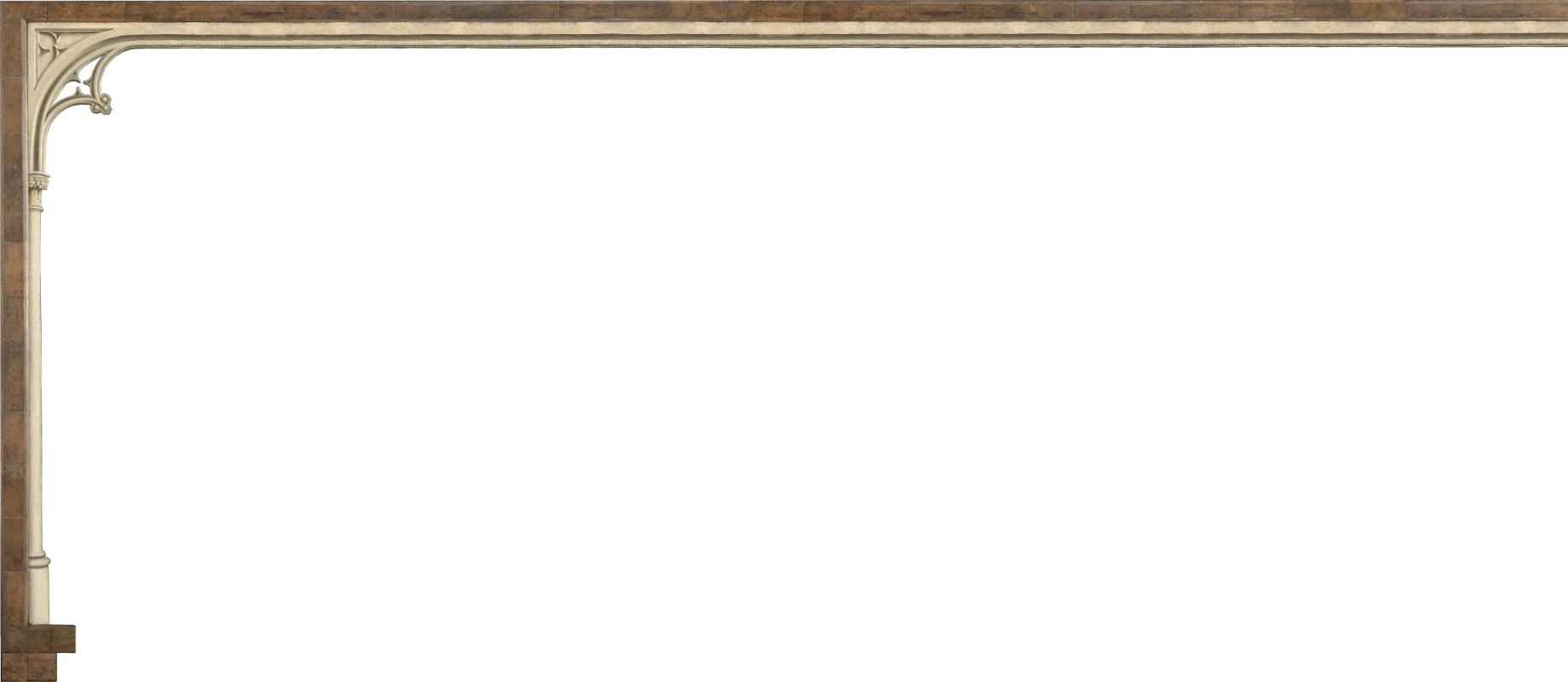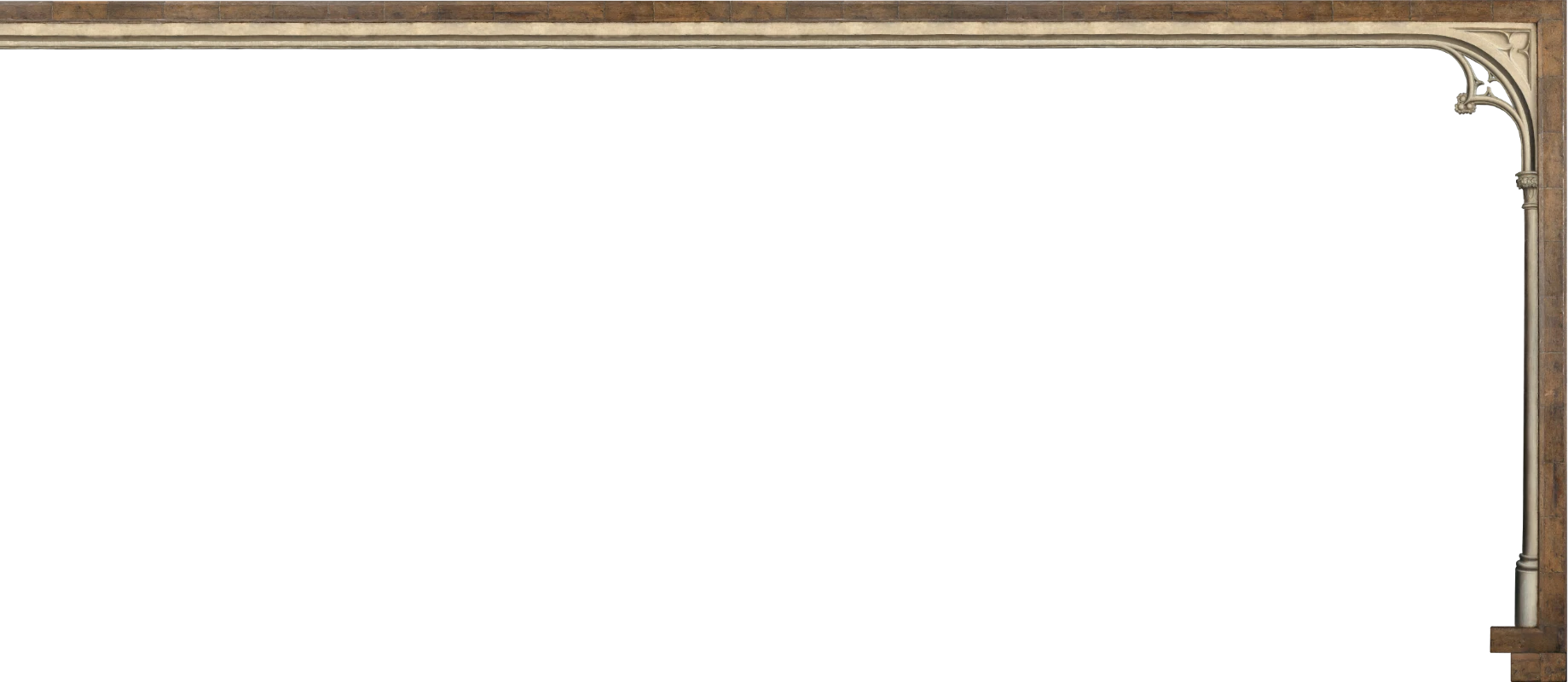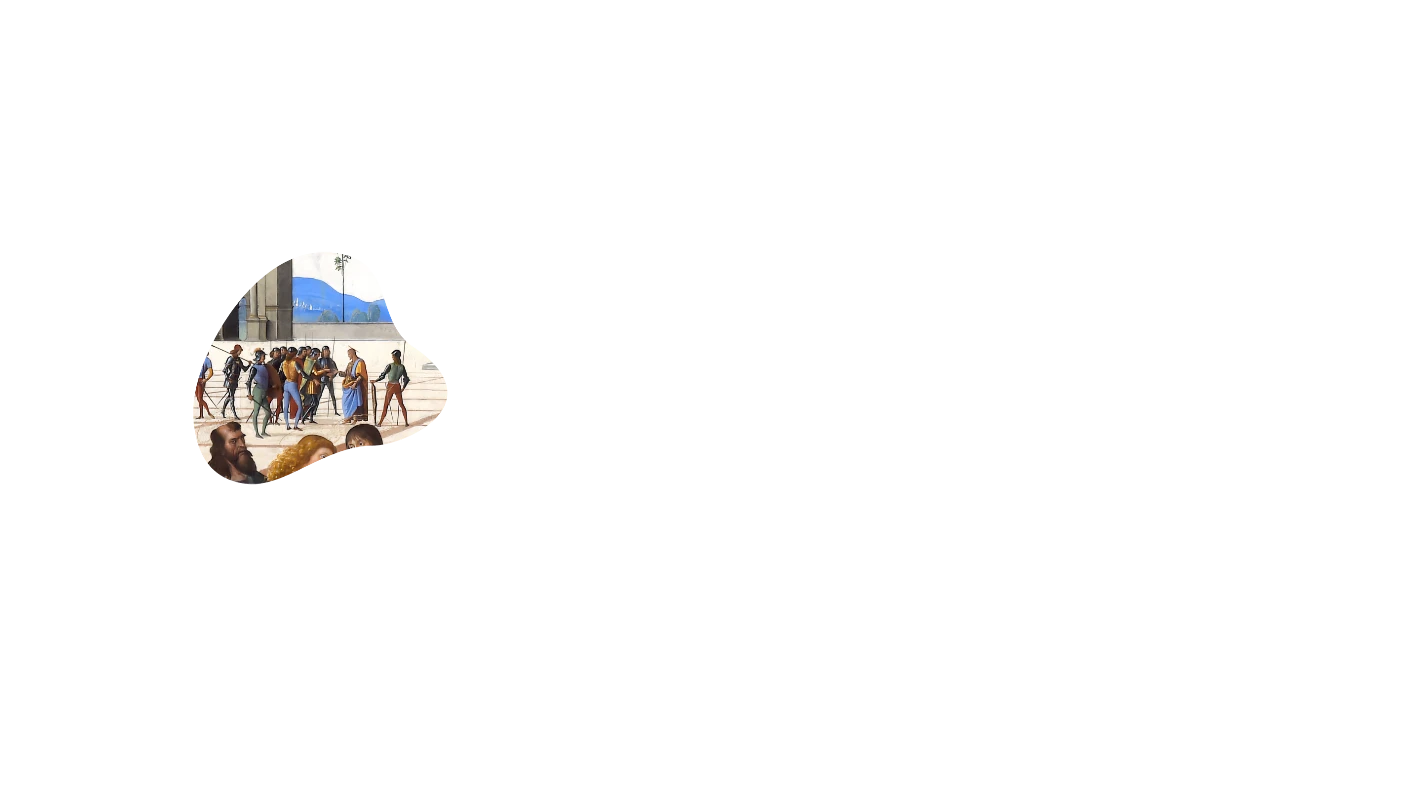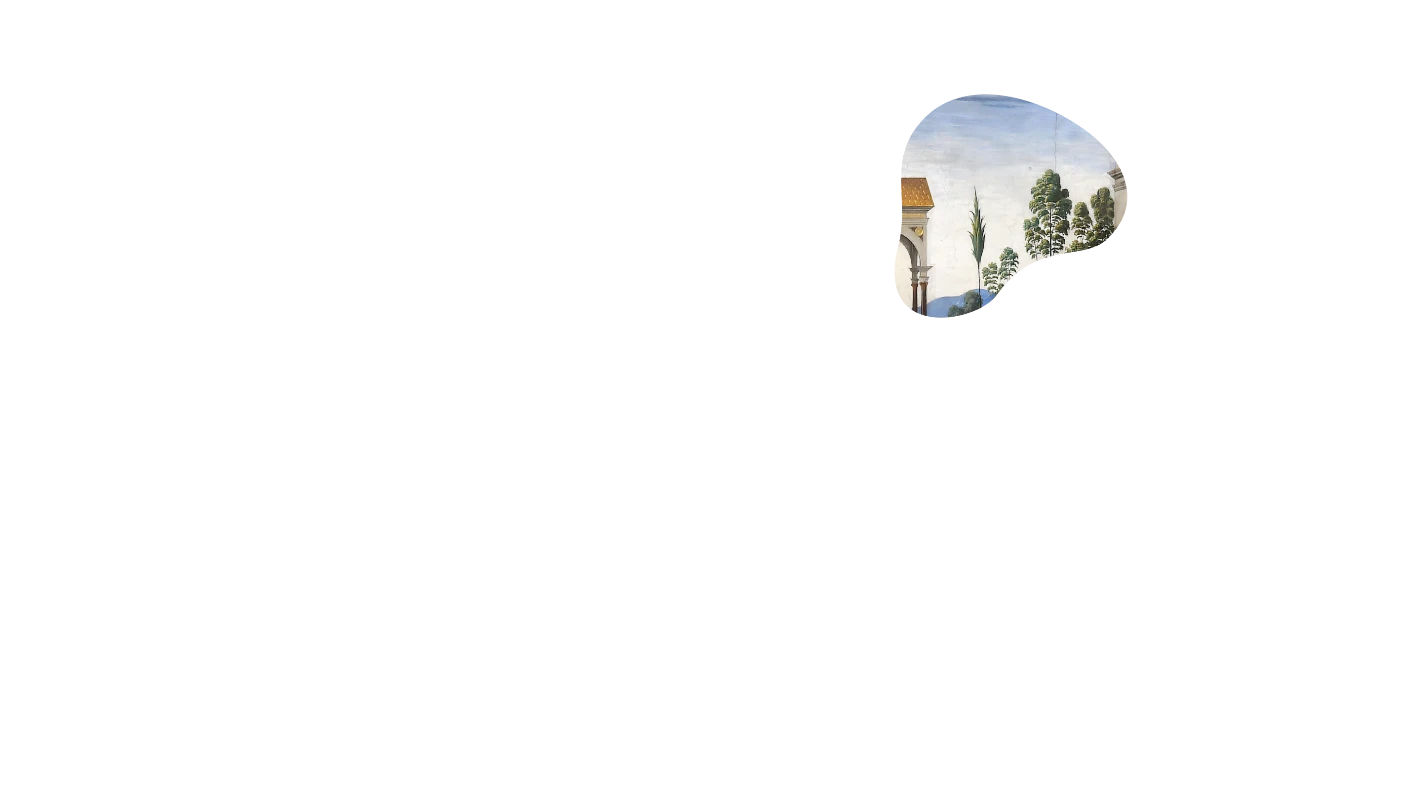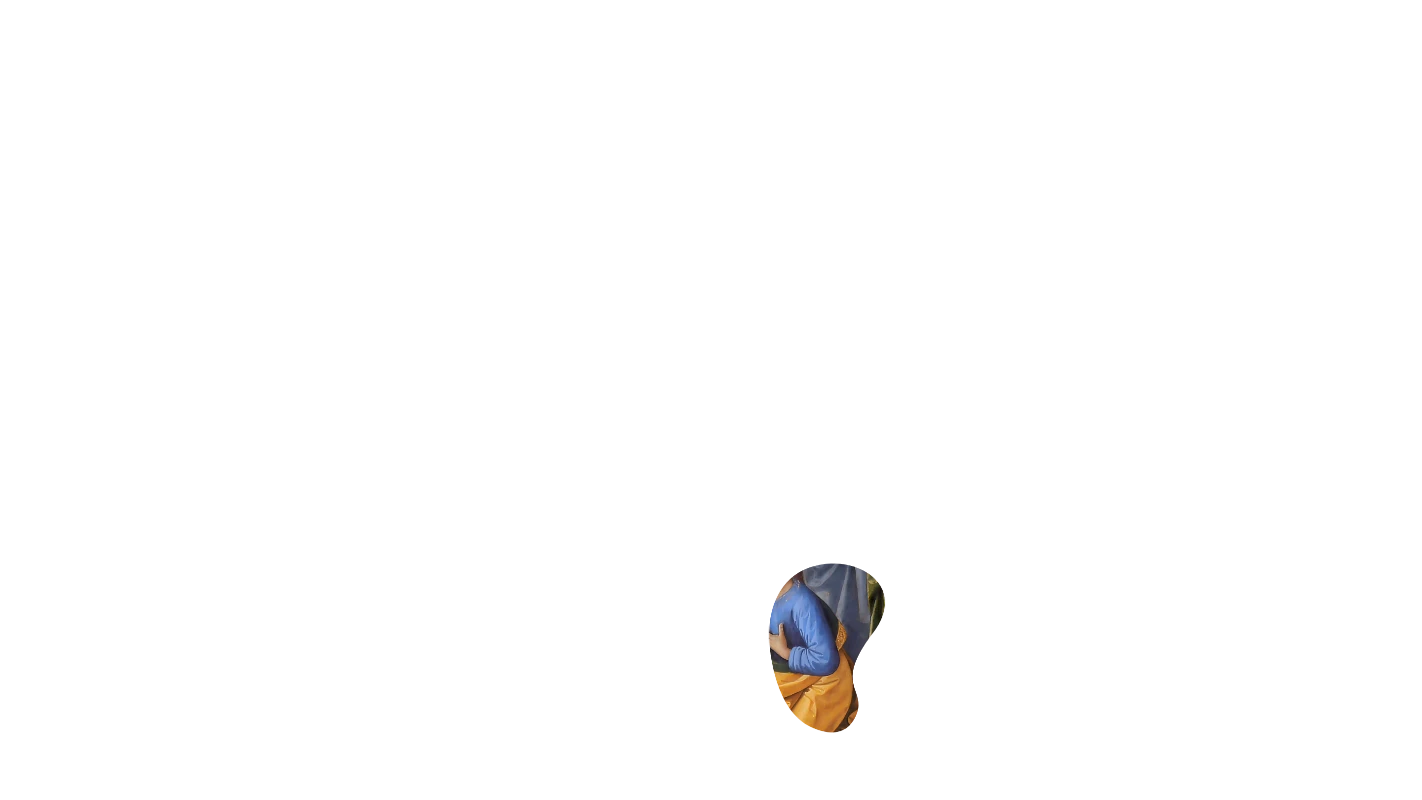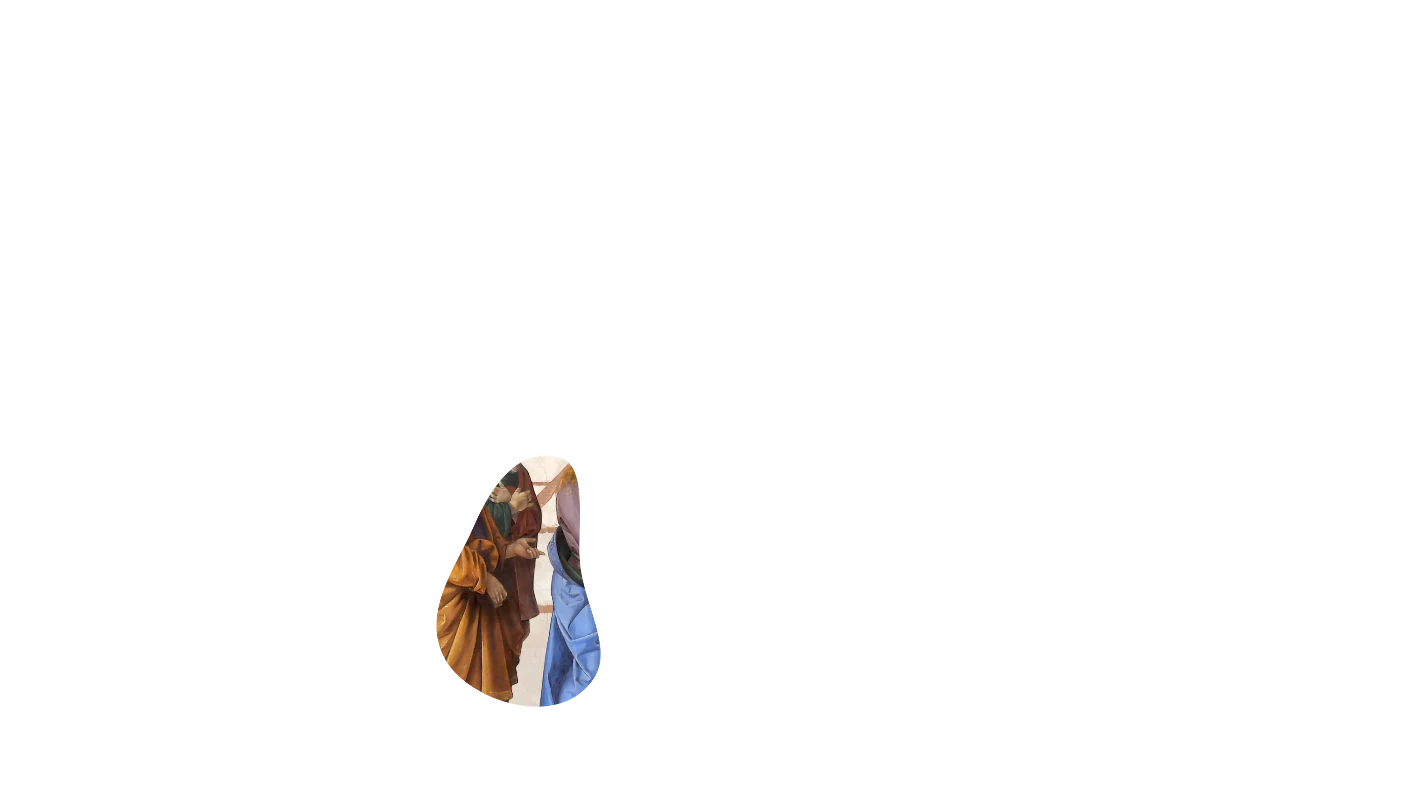In der Josquin-Forschung besteht kaum Uneinigkeit darüber, dass es sich bei der Missa Une mousse de Biscaye, die wahrscheinlich um 1475 in Frankreich entstand, entweder um Josquins erste oder – nach der Missa L’ami Baudichon – zweite Vertonung des Messordinariums handelt. Sie basiert auf einer weltlichen Melodie mit einem Text in französischer und baskischer Sprache. Das französische Wort „mousse“ im Titel leitet sich vom kastilischen Wort „moza“ ab, was „Mädchen“ bedeutet; die Biskaya ist eine Provinz im Norden Spaniens, die zum Baskenland gehört und deren Hauptstadt Bilbao ist. Das Lied ist ein Dialog zwischen einem jungen Mann, der Französisch spricht, und einem baskischen Mädchen, das auf alle seine amourösen Anträge mit dem rätselhaften Refrain „Soaz, soaz, ordonarequin“ reagiert. Die Verwirrung in der Kommunikation des Pärchens könnte das tonale Umherwandern des Liedes erklären, das in F beginnt, dann schnell in G kadenziert, nach F zurückkehrt, doch schließlich in B endet.
Wie bei einem Frühwerk nicht anders zu erwarten, ist Une mousse de Biscaye voll von eigenwilligen Details.
Wie bei einem Frühwerk nicht anders zu erwarten, ist die Missa Une mousse de Biscaye voll von eigenwilligen Details. So ist das beispielsweise das Agnus Dei eine exakte Wiederholung des Kyrie – einmalig in Josquins Messvertonungen. Verglichen mit späteren Standards finden sich einige „ungrammatikalische“ Dissonanzen und Auflösungen, und bis zu einem gewissen Grad spiegelt die Messe auch die modale Unsicherheit des Originals wieder, die ihre Klangwelt von der späterer Werke abhebt: Durchweg treten Töne im Tritonusabstand (E und B, Es und A) gemeinsam auf. Oft werden solche Sonderbarkeiten als Zeichen kompositorischer Unreife gedeutet. Ich als Dirigent kann dagegen bezeugen, wie effektvoll sie sein können – z.B. der Einsatz des Alts in Takt 64 des Sanctus (bei „Pleni sunt caeli“) auf einem E, der ausgefallen klingt und schwer zu intonieren ist, aber für echten Nervenkitzel sorgt.

Die Melodie der Chanson wird in Une mousse de Biscaye recht frei behandelt – sie erklingt zu unterschiedlichen Zeitpunkten in allen Stimmen und mit verschiedenen Erweiterungen und Ausschmückungen. Eben diese Erweiterungen verleihen der Komposition ihren fantasieartigen Charme, insbesondere im Credo, das im Vergleich mit den anderen Teilen ungewöhnlich lang ausfällt. Es enthält eines der extremsten Beispiele mathematischer Cantus-Firmus-Verarbeitung, die man sich vorstellen kann: Die Melodie wird gleichzeitig in vierfacher Augmentation und in Umkehrung zitiert. Das stellt die Tenöre vor erhebliche Probleme, da sie nicht nur sehr tief – aufgrund der Umkehrung –, sondern wegen der Verlängerung der Notenwerte auch minutenlang quasi ohne Atempause singen müssen. Die resultierende Klangwirkung ist dafür aber besonders einprägsam – ein tiefer Bordun, dunkel und gedämpft, oftmals noch unterhalb der Bassstimme.
© Peter Phillips / Gimell Records, deutsche Übersetzung von Viola Scheffel