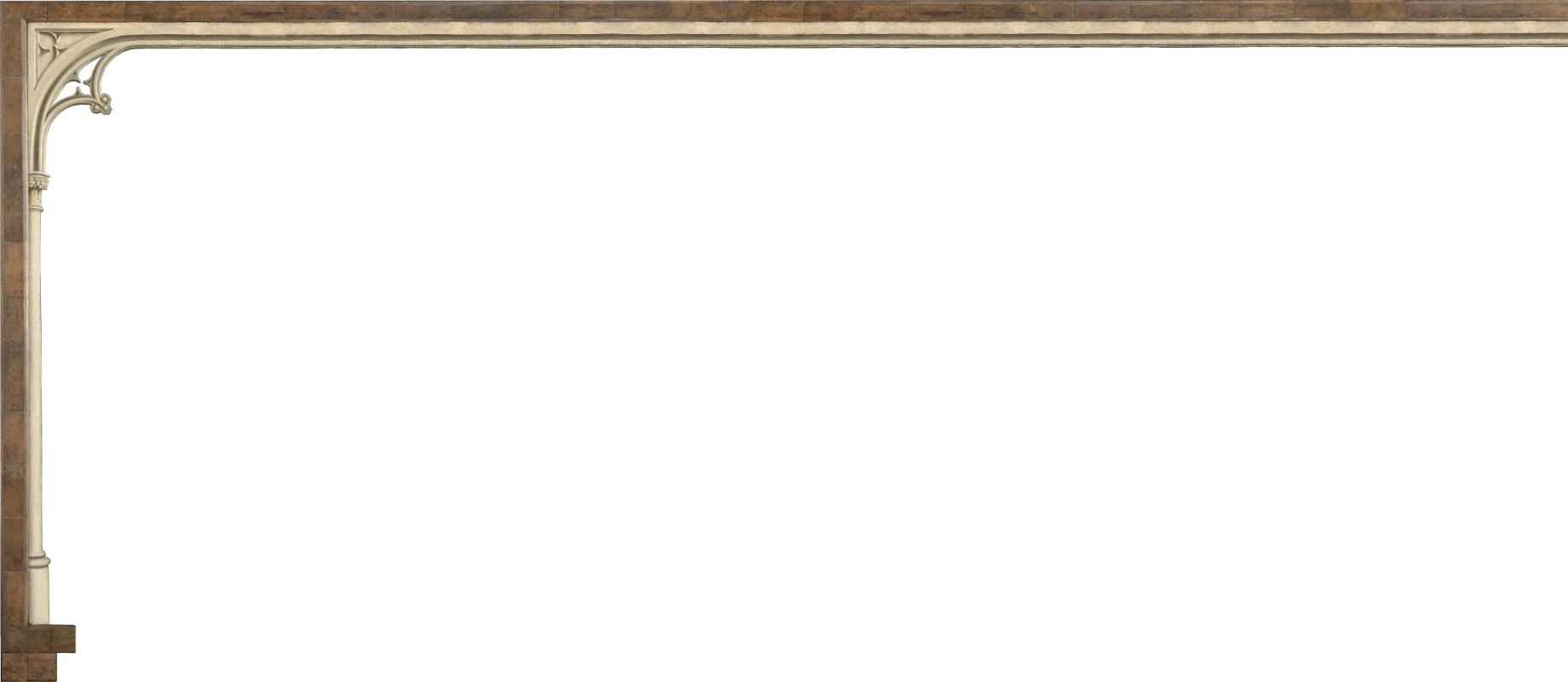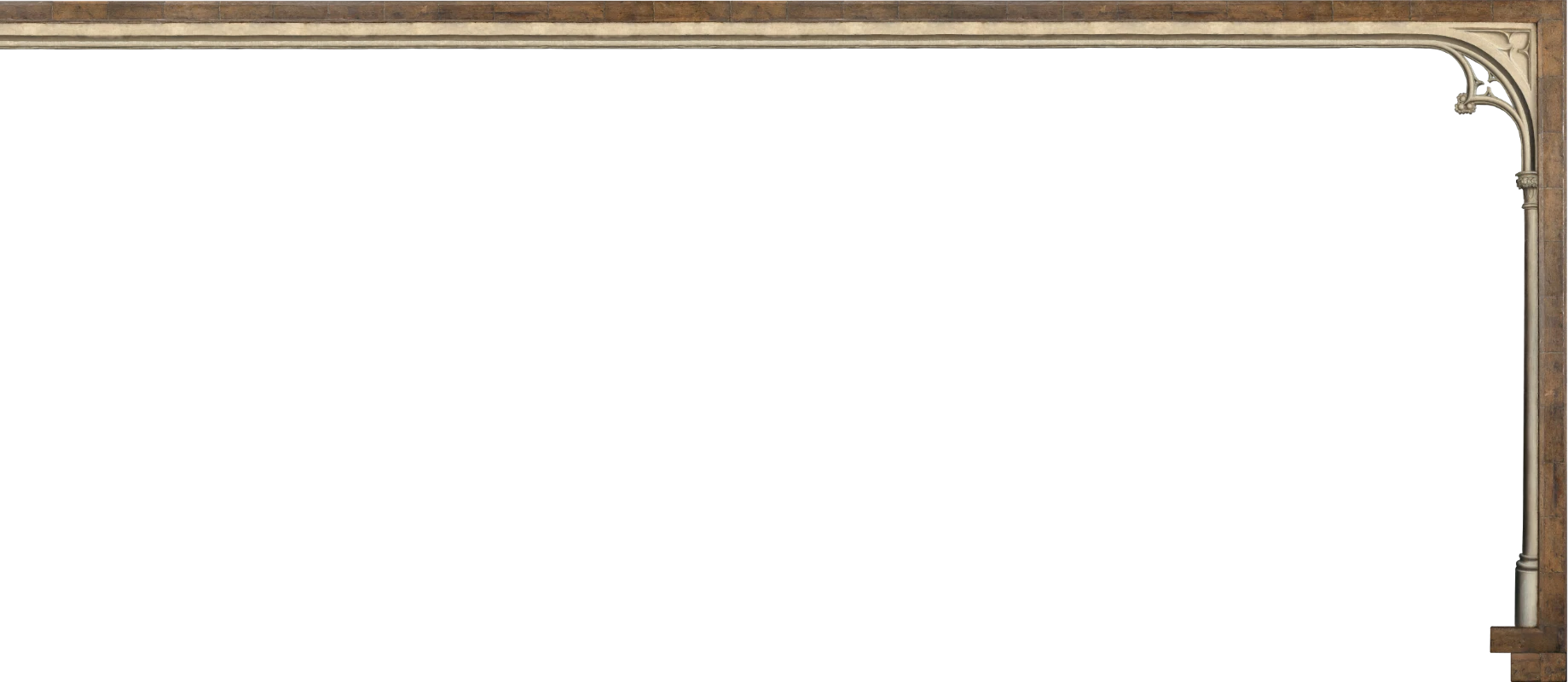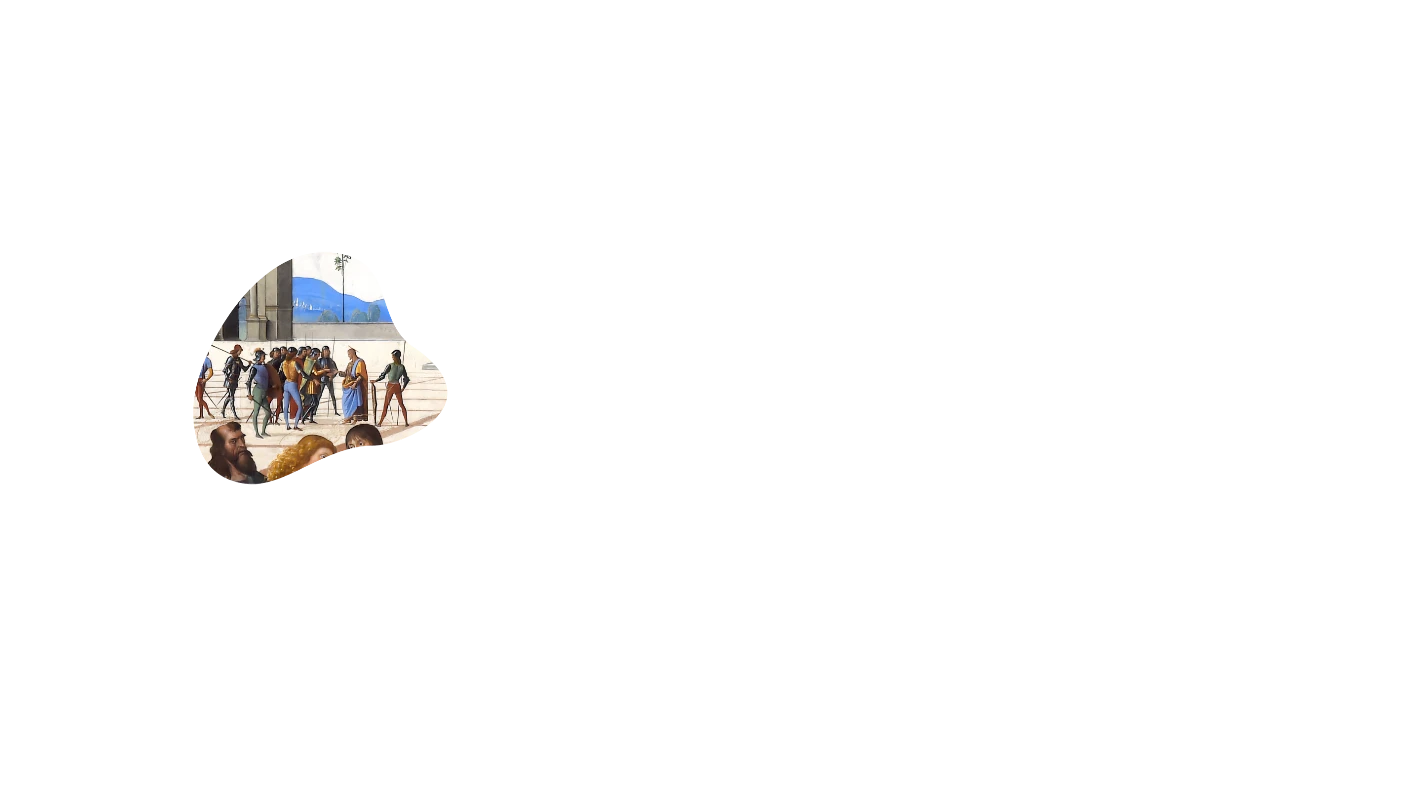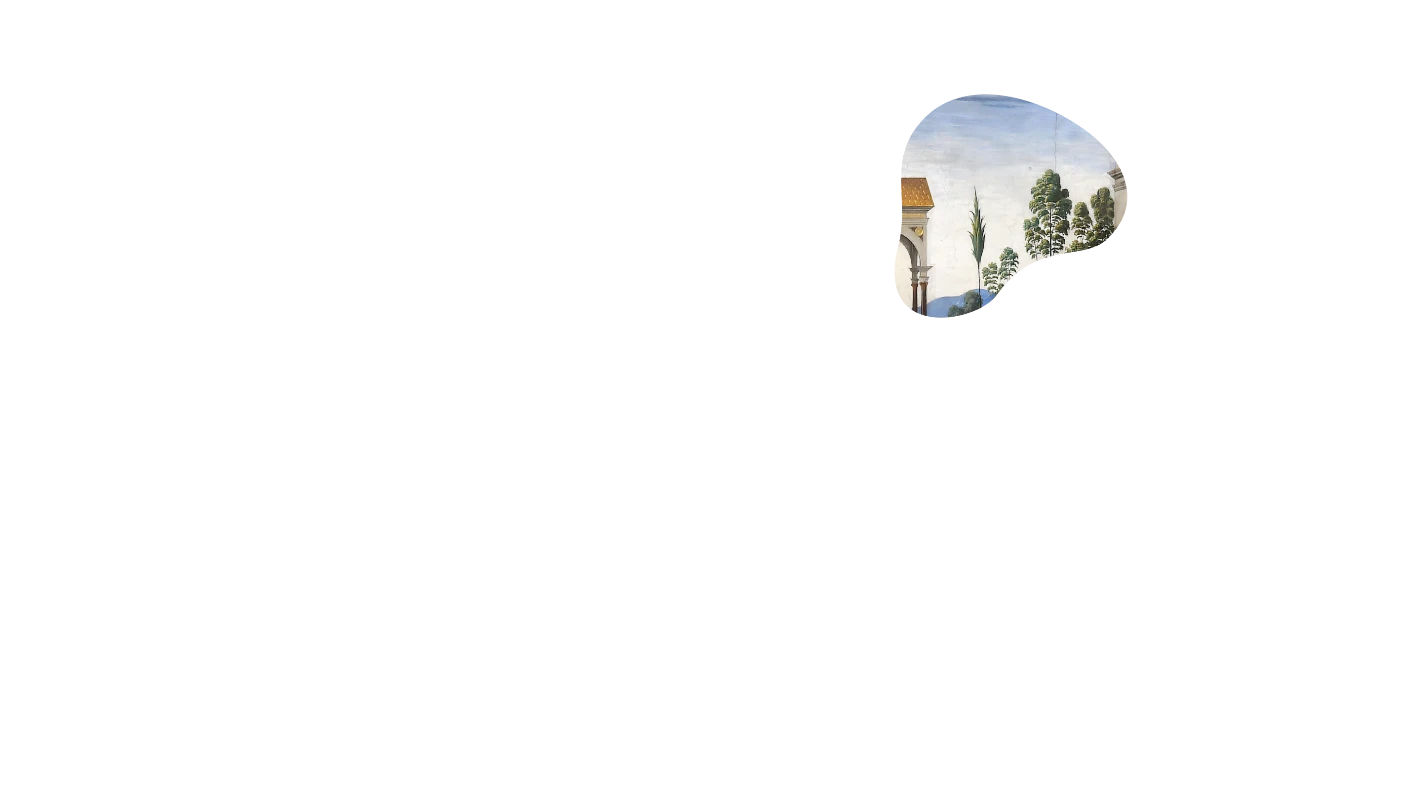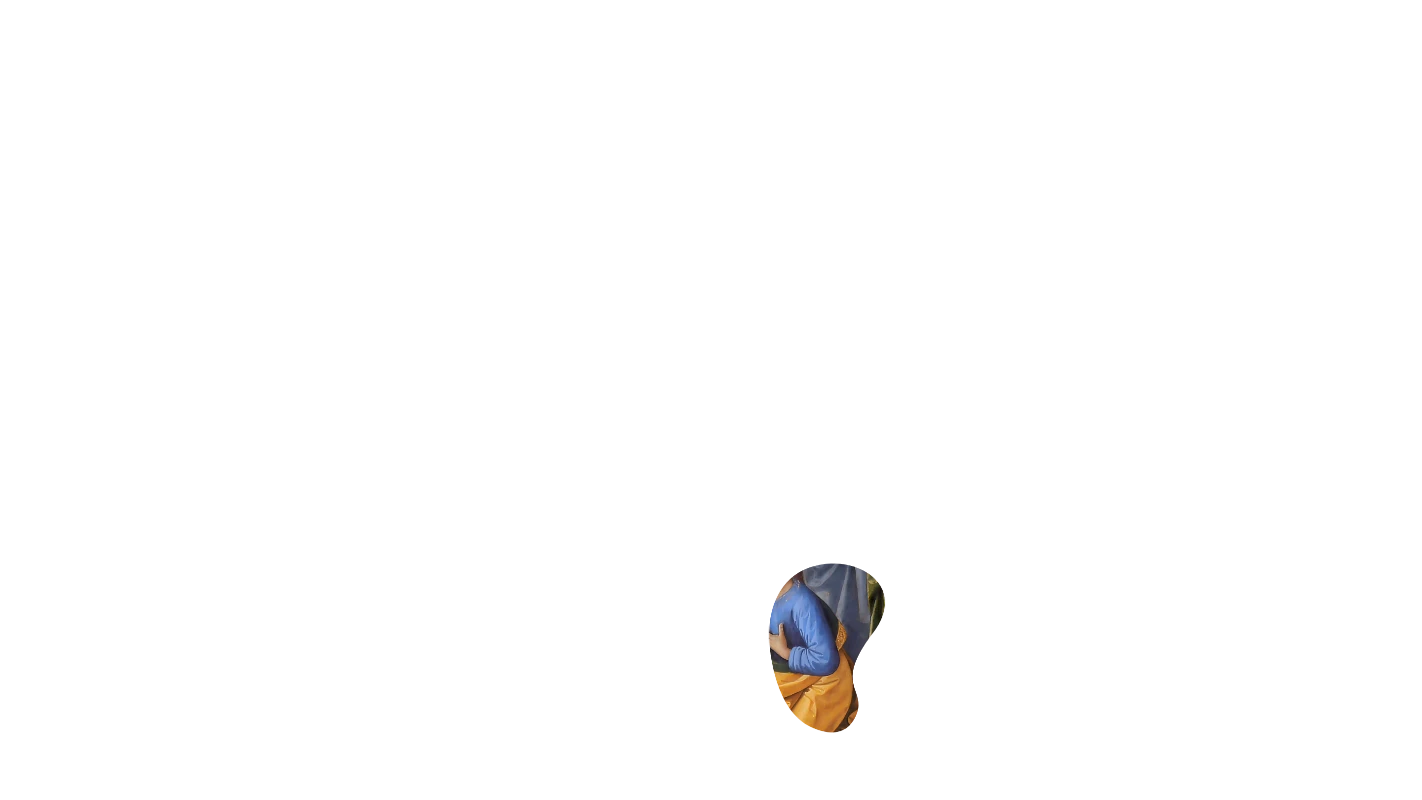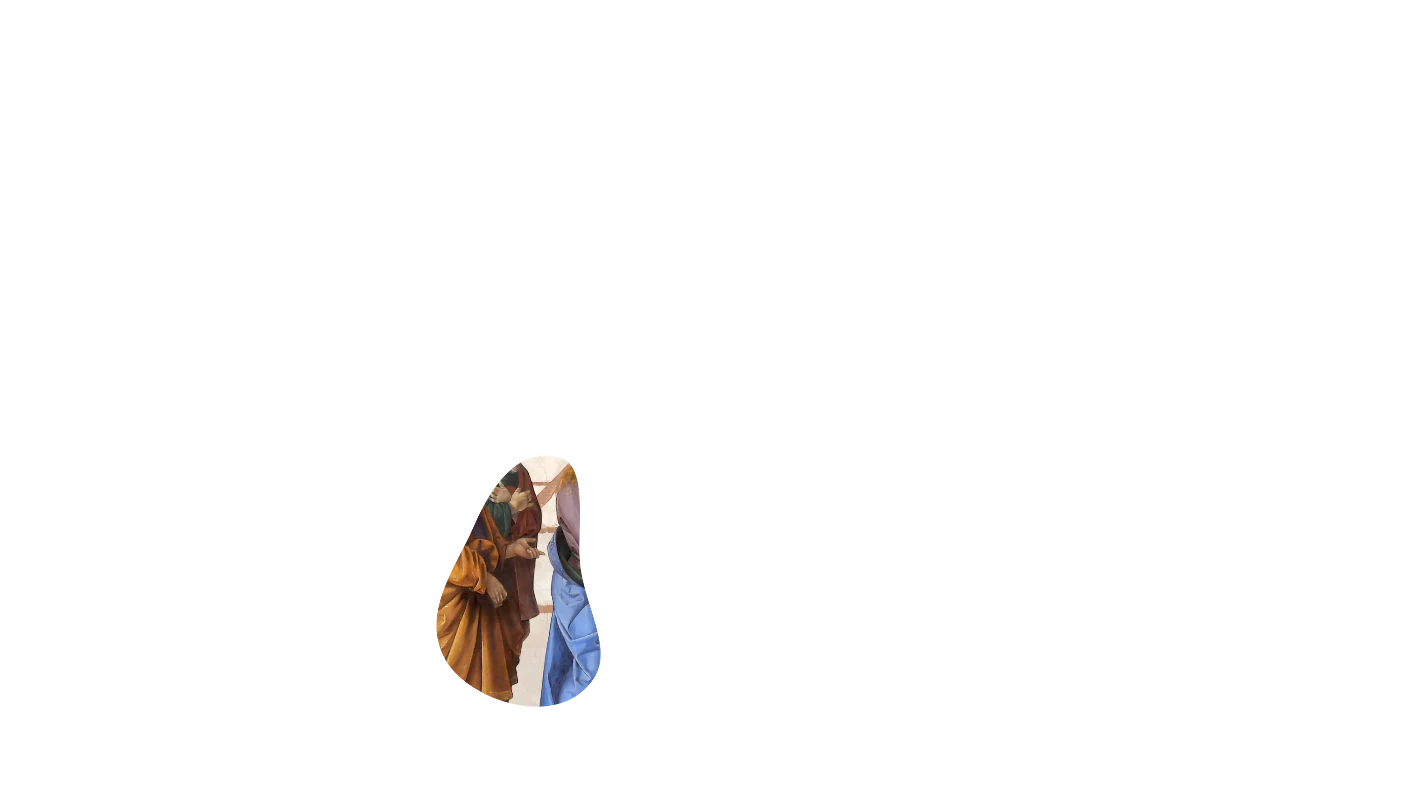Die Missa De beata virgine ist, der letzten Zählung zufolge, in nicht weniger als 69 Quellen überliefert, was sie mit Abstand zur am weitesten verbreiteten Messe Josquins macht. Zugegebenermaßen befinden sich darunter einige sehr lückenhafte Transkriptionen, doch ist sie in fünf wichtigen Chorbüchern jeweils als erste Nummer verzeichnet. Diese Popularität ist faszinierend, da es ihr aus heutiger Sicht an musikalischer Geschlossenheit mangelt. Wir erwarten heute, dass eine mehrsätzige polyphone Messvertonung einen hörbaren Zusammenhang aufweist, wie etwa eine Symphonie oder ein Instrumentalkonzert. In vielen Vertonungen des 16. Jahrhunderts ergibt sich dieser Zusammenhang durch das Verwenden einer durchgängigen Vorlage, deren Hauptcharakteristika regelmäßig im Laufe des Werks zitiert werden.
Die Popularität der Missa De beata virgine ist faszinierend, da es ihr aus heutiger Sicht an musikalischer Geschlossenheit mangelt.
In De beata virgine ergibt sich Zusammenhang jedoch einzig durch das schon zu ihrer Entstehungszeit sehr altmodische Zitieren von verschiedenen Gesängen, die ein gemeinsames Thema haben – in diesem Fall die Marienfeste. Im musikalischen Sinne motivischer und sogar tonaler Zusammenhalt sind also liturgischen Gesichtspunkten untergeordnet. Auch die Tatsache, dass ab dem Credo die vierstimmige Anlage auf fünf Stimmen erweitert wird, deutet darauf hin, dass das Werk möglicherweise gar nicht als musikalische Einheit konzipiert war.

Choral-Paraphrasen sind in diesem Werk das Hauptkonstruktionsprinzip, wobei Gesänge in verschiedenen Modi verwendet werden (in der Reihenfolge der Sätze handelt es sich dabei um Modus I, VII, IV, VIII und VI). Tatsächlich sind diese Modi so unterschiedlich, dass darauf hingewiesen worden ist, Josquin verarbeite hier möglicherweise absichtlich in virtuoser Weise verschiedene modale Verhältnisse, was ein plausibler, wenn auch ungewöhnlicher Grund für seine Vorgehensweise wäre. Möglich ist es, jedenfalls zieht es für moderne Chöre unliebsame Konsequenzen nach sich, etwa uneinheitliche Stimmumfänge (das Credo etwa muss um eine Quarte nach oben transponiert werden, um es überhaupt ausführbar zu machen). Was hat man also davon? Die Vorzüge sind subtil, können aber heute ebenso deutlich in Erscheinung treten, wie es offenbar bei den ersten Aufführungen der Fall war.
Man kann nur spekulieren, warum so viele Autoren aus Zeiten, als die Polyphonie längst eine tote Kunst war, derart von der Missa De beata virgine beeindruckt waren, doch war die Eleganz ihrer Komplexität sicherlich ein Grund dafür.
Die Hauptattraktion sind die Kanons, die den fünfstimmigen Sätzen (Credo, Sanctus und Agnus Dei) zugrunde liegen. In allen drei Sätzen erklingt in jeweils zwei Stimmen die Choralmelodie in einem reinen Quintkanon. Um die Wirkung noch zu intensivieren, fügte Josquin an einigen Stellen noch Melodien im Dreiertakt hinzu, die über und um die Kanons herum gelegt sind. Dies resultiert in einer der berühmtesten Josquin-Passagen überhaupt: der Teil des Credos, der bei „Qui cum Patre“ beginnt. Selbst für Musiktheoretiker der Mitte des 18. Jahrhunderts war dieses Material unwiderstehlich, es wurde immer wieder zitiert. Die beiden Tenorstimmen ergehen sich in schlichter kanonischer Deklamation, während die Altstimmen und Bässe die Linien der beiden aufgreifen. Darüber singen die Sopranstimmen eine langsame Triolenmelodie von müheloser Schönheit. Man kann nur spekulieren, warum so viele Autoren aus Zeiten, als die Polyphonie längst eine tote Kunst war, davon derart beeindruckt waren, doch war die Eleganz der Komplexität sicherlich ein Grund dafür.
© Peter Phillips / Gimell Records, deutsche Übersetzung von Viola Scheffel